
Verdrängt aus den USA und Europa: Sucht sich Binance eine neue Heimat in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE)? Die Krypto-Börse wünscht sich Sicherheit im Aufbau.

Verdrängt aus den USA und Europa: Sucht sich Binance eine neue Heimat in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE)? Die Krypto-Börse wünscht sich Sicherheit im Aufbau.

Erst im Mai verkündete Binance den Handel von Privacy Coins in mehreren europäischen Ländern auszusetzen. Doch die Kryptobörse kippt die Entscheidung kurzfristig und hebt einen generelles Delisting auf.

Nach und nach schließen sich die Türen für Binance in Europa. Nun gerät die Krypto-Börse auch ins Visier der belgischen Regulatoren.

Europa verliert technologisch und wirtschaftlich an Relevanz. So offensichtlich diese Beobachtung sein mag, gibt es aber auch Hoffnungsschimmer. Warum gerade der Kryptosektor zu einer neuen europäischen Emanzipation führen kann.

Die Tinte ist trocken. Vertreter des EU-Parlaments und des Rats unterzeichnen den finalen Entwurf zur MiCA-Regulierung. Bis zum Inkrafttreten ist es nicht mehr weit.

Die weltweit größte Kryptobörse streicht in mehreren europäischen Ländern Privacy Coins aus dem Sortiment. Der Grund: Regulierungsdruck.

Seit dem 20. April 2023 hat die EU die Krypto-Regulierung MiCA. Wir wollten von euch wissen, was ihr davon haltet.
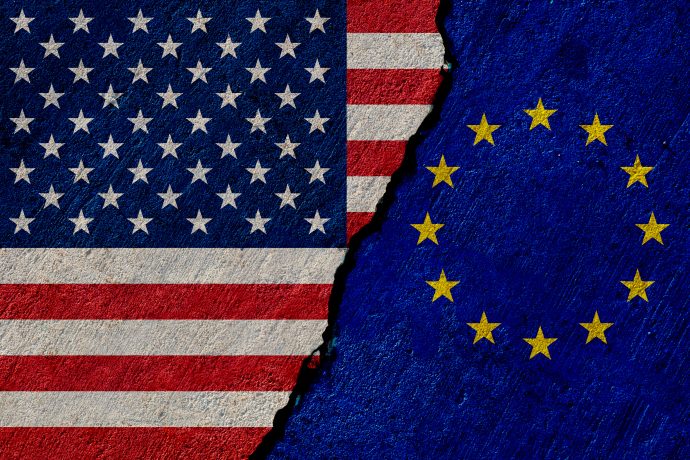
Die USA gehen gegen den Krypto-Sektor vor. Townsend Lendsing, Head of Product von CoinShares, ordnet die Regulierung ein und spricht Europa innovatives Entwicklungspotenzial zu.

Die USA gehen hart gegen den Krypto-Sektor vor. Die Europäische Union könnte das als Chance nutzen. Doch wird sie es auch?

Das finnische Tech-Unternehmen Membrane Finance hat den Start des EU-regulierten Stablecoin EUROe bekannt gegeben.

Wie das digitale Europa in Zukunft aussehen wird, steht noch in den Sternen. Eines ist jedoch klar: Tokenisierung ist der Schlüssel zum Erfolg, sagt ein Bericht.

In der EU ist DeFi bisher noch unreguliert. Nun veröffentlichten verschiedene Experten des Sektors erste Überlegungen. Ein Überblick.

Anleger im Krypto-Space sollten in der ersten Woche des neuen Handelsjahres folgende Wirtschafts- und Finanzdaten im Blick haben.

Anleger im Krypto-Space sollten in der aktuellen Handelswoche folgende Wirtschafts- und Finanzdaten für zukünftige Kurs-Prognosen Blick haben.

Anleger im Krypto-Space sollten in der aktuellen Handelswoche folgende Wirtschafts- und Finanzdaten für zukünftige Kurs-Prognosen Blick haben.

Anleger im Krypto-Space sollten in der aktuellen Handelswoche diese Wirtschafts- und Finanzdaten genau im Blick haben.

Das EU-Parlament bringt neue Forderungen in den MiCA-Trilog ein. Schlimmstenfalls könnten diese zu einem Verbot von PoW-basierten Kryptowährungen wie Bitcoin führen.

Madeira gilt innerhalb der EU als Steuerhafen. Damit sich die autonome Region aber als Bitcoin-Paradies etablieren kann, muss sich Präsident Miguel Albuquerque noch gegen die Zentralregierung in Lissabon durchsetzen. Denn die hat andere Pläne.